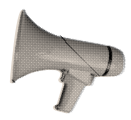Zeitdiagnose als Krisendiagnose – Was leistet die Regulationstheorie heute?
Rekonstruktionen der Theoriegeschichte
Der Startimpuls der Regulationstheorie war nicht nur mit der seit den Siebzigern evidenten Krise des Fordismus verknüpft, sondern auch mit der Einflusschance, die die Präsidentschaft Mitterand Anfang der Achtziger einer kritischen politischen Ökonomie zu bieten schien. So bildet sich laut Joachim Becker neben einem „methodologischen Marxismus“ (25), der an der konkreten Analyse mittelfristiger Entwicklung der kapitalistischen Ökonomie interessiert ist, eine linkskeynesianische, institutionalistische Strömung heraus, die „auf eine Politik progressiver Reformen“ (26) orientiert ist.
Die Jahrzehnte seitdem waren reich an weiteren Differenzierungsanstößen, sei es aus den sozialwissenschaftlichen Theorieentwicklungen, sei es aus Frauenbewegung und Genderforschung oder ökologischen Fragestellungen. So führt der sozialwissenschaftliche cultural turn Bob Jessop und Ngai-Ling Sum zum Vorschlag einer „kulturelle(n) politische(n) Ökonomie“, da Sinnerzeugung „ko-konstitutiv für das Kapitalverhältnis“ (57f.) sei. Brigitte Aulenbacher und Birgit Riegraf zeigen, wie bereits seit den Achtzigern die feministische Forschung die „konzeptionelle Selbstbeschränkung“ der Regulationstheorie auf marktvermittelte Ökonomie und die Kategorie Klasse kritisiert und die Notwendigkeit einer Öffnung des regulationstheoretischen Blicks aufgewiesen hat; und seitdem hat – ein weiteres starkes Argument – die Krisenbearbeitung des Kapitals sich eben der un- und unterbezahlten Ressourcen bedient, die nur über die Kategorien Geschlecht und Ethnie zu erschließen sind. Eine neue Herausforderung der Regulationstheorie stellt auch der „grüne Kapitalismus“ dar, zu dem sich das neue Politikfeld der Ökologie durch seine ökonomische Umcodierung gewandelt hat. In den Blick der Regulationstheorie geraten damit, wie Ulrich Brand und Matthias Wissen herausarbeiten, „die gesellschaftlichen Formen der Aneignung von Natur: also die Formen, wie gesellschaftliche Basisbedürfnisse wie Ernährung und Wohnen, Mobilität und Kommunikation, Gesundheit und Fortpflanzung materiell und symbolisch befriedigt werden“ (138) und die für gegenwärtige Krisendiagnose wichtige Frage, ob „die Green-Economy-Strategie“ zum „Kristallisationspunkt einer neuen kapitalistischen Formation“ (141) wird.
Schärfung der theoretischen Grundbegriffe
Ein zweites Gravitationszentrum des Bandes bildet die innertheoretische Vergewisserung, die Prüfung von Grundannahmen und Stimmigkeit, die Schärfung der Grundbegriffe der Regulationstheorie. Warum eigentlich Regulationstheorie? Und was hat es mit dem zweiten Zentralbegriff, dem Akkumulationsregime, auf sich? Halten sie der Kritik und den Anforderungen der Empirie stand? Wenn Akkumulation den harten Kern des Kapitalismus, seinen Antriebsmotor, den inneren Zwang zur Verwertung des Werts, bezeichnet, so Akkumulationsregime die historisch jeweils vorherrschende Akkumulationsstrategie. Im Fordismus war dies, um eine der von Joachim Becker genannten „Akkumulationsachsen“ aufzugreifen, eine „produktive“, im Postfordismus oder „marktradikal deregulierten Kapitalismus“ (Hirsch:, 381) dagegen eine „finanziarisierte Akkumulation“ (37). Mit Hilfe weiterer Achsen (extensive/intensive Akkumulation; intravertierte/extravertierte Akkumulation) lassen sich mit Joachim Becker zeitlich und räumlich differenzierte Akkumulationsmuster sowie deren oft komplementäre Beziehung zueinander bestimmen.
Feld begrifflicher Schärfungen ist aber vor allem die Regulationsseite der Theorie. Wenn mit Regulation das Ensemble der gesellschaftlichen und politischen Ermöglichungsbedingungen der kapitalistischen Ökonomie und mit Regulationsweise ihre konkrete, auf ein bestimmtes Akkumulationsregime bezogene Ausprägung gemeint sind, so versteht sich, dass der an Kräfteverhältnissen und deren Veränderung interessierte Blick diesen Prozeduren der Zustimmungserzeugung und Widerspruchsbearbeitung und der Auseinandersetzungen darum besondere Aufmerksamkeit widmet.
Wie Birgit Sauer hervorhebt, ist es die durch den Regulationsbegriff bewirkte Blicköffnung, die es möglich macht, „neben produktiver Arbeit auch reproduktive Arbeit als Dimension kapitalistischer Akkumulation und Vergesellschaftung und zweitens Geschlechterverhältnisse als zentrale Dimension der Regulation zu denken“ (117). Diese Erweiterung, so Birgit Sauer, hat sich im Aufweis der Fordismus-Krise als einer Krise des mals-breadwinner-Modells ebenso bewährt wie in der Analyse der „erneut geschlechterungleiche(n), wenn auch geschlechterparadoxen“ (121) neoliberalen Restrukturierung der Ökonomie.
Die diese neoliberale Restrukturierung flankierende Agitation – erinnert sei an Kohls „soziale Hängematte“ und die ständig skandalisierende Standortdebatte – hatte insbesondere die Demontage des Sozialstaats zum Ziel. Wie Roland Atzmüller zeigt, kann die Transformation des Sozialstaats in Richtung auf das angelsächsische Workfare-Modell gerade mit regulationstheoretischen Begriffen als kennzeichnender Zug der neuen postfordistisch-neoliberalen Regulationsweise beschrieben werden – als Versuch, „die Ausweitung prekärer Arbeitsverhältnisse, die Etablierung großer Niedriglohnsektoren (…) und die Polarisierung der Einkommensstrukturen so zu regulieren, dass deren gesellschaftliche Auswirkungen (…) nicht in Widerspruch zur Wettbewerbsfähigkeit und ökonomischen Dynamik geraten“ (159f.).
Martina Sproll hingegen merkt weiteren begrifflichen Schärfungsbedarf an. Sie kommt zu dem Schluss, dass der „Regulationsansatz (…) nur begrenzt nützlich“ (183) sei und durch arbeitspolitische Konzepte, Bourdieusche Kategorien und Ansätze der Geschlechterforschung ergänzt werden müsse. Auch Roland Henry und Vanessa Redak konstatieren für ihr Untersuchungsfeld „Geldverhältnis und Krise“ deutliche Defizite der Regulationstheorie. Bedenkt man, welch wichtige Rolle die Geldpolitik im globalen Umbruch zum marktradikal deregulierten Kapitalismus und in dessen Krise seit 2008 gespielt hat, ist das eigentlich verwunderlich. Henry und Redak können diese Lücke durch dicht analysierende und zugleich historisch erzählende Darstellung zum guten Teil füllen.
Krisendiagnosen
Andere Beiträge zeigen überzeugend, dass die Regulationstheorie, am Fordismus und seiner Krise entwickelt, auch zur Analyse des neuen Akkumulationsregimes und dessen andauernder Krise taugt. Alex Demirović und Thomas Sablowski vertiefen und erweitern in einem umfangreichen Beitrag ihre zuerst in Prokla 166 (2012) vorgelegte Untersuchung über die „Finanzdominierte Akkumulation und die Krise in Europa“. Die Debatte, die sich mittlerweile gerade am empirischen Zugriff der Autoren entfaltet hat (Becker, Panzer und die Replik von Sablowski auf beide), belegt m. E. die Triftigkeit und blicköffnende Qualität einer empirisch gestützten Profilierung des neuen Akkumulationsregimes gerade auch für den Zusammenhang von regulationstheoretisch geleiteter Krisenanalyse und – kontroversen – politischen Folgerungen. Einer der wichtigsten strittigen Punkte betrifft die regulationstheoretische und politische Einschätzung der Rolle – oder Sonderrolle – Deutschlands: Rührt seine relative Stärke nicht gerade aus dem Fortbestand eines produktivistischen, exportorientierten Akkumulationsregimes? Spricht das nicht gegen eine schon durchgesetzte, vereinheitlichende Dominanz eines finanzialisierten Akkumulationsregimes in Europa? Und lassen sich politische Strategien im Interesse der Vielen tatsächlich europäisch und in einer fortbestehenden Eurozone formulieren?
Ebendiese europäischen Entwicklungs- und Krisendifferenzen werden aus unterschiedlichen Perspektiven, doch an jeweils hoch interessanten Fokussierungen in weiteren Beiträgen thematisiert. Bernd Röttger diskutiert vor dem Hintergrund einer kritischen Prüfung der Regulationstheorie als Krisentheorie die „eigentümliche Kontinuität des ‚Modells Deutschland‘“, Hans-Jürgen Bieling arbeitet die Vorzüge der Regulationstheorie vor dem Varieties of Capitalism-Ansatz heraus und erprobt sie an der Analyse der Krisenpolitik in der EU. Susanne Heeg entwickelt aus der zugleich spannungsreichen wie komplementären theoretischen Konfiguration von „Wettbewerbsstaat und finanzdominierte(m) Akkumulationsregime“ (261) ein Untersuchungskonzept, welches die Beobachtung von „Rescalingprozessen, die gleichzeitig integrierte wie auch heterogene Räume schaffen“ (263) mit einem „Downscaling“ gesellschaftlicher Reproduktion auf individuelle Zuständigkeit verbindet, wie es mit dem „Akkumulationsregime des Vermögensbesitzes“ global durchgesetzt wurde (263f.). Die empirisch dichte Anwendung auf das Beispiel Spanien testet den theoretischen Zugriff und liefert eine erklärungsstarke Beschreibung der spezifischen, gleichwohl mit den globalen Mustern verknüpften spanischen Krise; sie macht zudem die besondere Bedeutung des Immobiliensektors für den in Frage stehenden Akkumulations- und Krisentypus überhaupt plausibel.
Jenseits des nordatlantischen Kapitalismus
Zwei Beiträge blicken schließlich über den Rahmen des nordatlantischen Kapitalismus hinaus. Saba Alnassari untersucht am „Fall Ägypten“ das Verhältnis von Regulation und Krise in der politischen Ökonomie der arabischen Revolution und er zeigt, wie die Übernahmen neoliberaler Instrumentarien die Widersprüche mit vorerst offenem Ausgang verschärft haben. Der andere Beitrag gilt dem aufsteigenden Champion der Weltwirtschaft, ohne dessen Rolle als Konkurrent und Retter zugleich die Krise seit 2008 vermutlich einen sehr viel desaströseren Verlauf genommen hätte. Dass China diese Rolle spielen und in seiner Position gestärkt aus der Krise hervorgehen konnte, liegt, wie Stefan Schmalz zeigt, an der fortbestehenden „Dominanz des Produktivkapitals“ (341) – weswegen die chinesische Krisenpolitik sich darauf konzentrieren konnte, die Einbrüche der Export-Produktion durch Infrastrukturinvestitionen abzufangen. Indem er die chinesische Wirtschaftsgeschichte seit der Öffnung 1978 in Begriffen der Regulationstheorie erzählt, also sowohl im analytischen wie im historischen Kontext darstellt, demonstriert Schmalz eindrucksvoll, wie erklärungskräftig sich auch ein anders und schneller verlaufender Wechsel von Akkumulationsregimen, wie in China zu beobachten, regulationstheoretisch beschreiben lässt.
Was wird aus der Regulationstheorie? Was wird aus der Krise?
Aus guten Gründen ist das letzte Wort des Bandes Joachim Hirsch vorbehalten und aus guten Gründen auch beantwortet er seine Titelfrage: „Was wird aus der Regulationstheorie?“ erst, nachdem er Verursachungszusammenhang und spezifische Erscheinungsform der gegenwärtigen Krise untersucht hat, um daraus auch prognostische Anhaltspunkte zu gewinnen. Viel spreche dafür, dass diese Krise tatsächlich die „Endkrise“ (383) der oft als Postfordismus bezeichneten Formation sei und sie „eine längere Krisenperiode“ sein werde, „die nicht nur ökonomische, sondern auch gravierende politische und soziale Dimensionen hat“ (387). Der Regulationstheorie täte mithin gut, ihre Perspektive von der Erklärung stabilerer Akkumulationsregime auf ihre krisendiagnostischen Potenziale zu verschieben. Um sich abzeichnende Entwicklungen zu einem „stärker autoritär-staatsmonopolistisch regulierte(n) Kapitalismus“ zu erfassen, der die „relative Autonomie des Staates“ keineswegs stärke, sondern durch „neue Formen einer ‚economic governance‘“ (388f.) schwäche, müsse die Regulationstheorie ihre „staatstheoretische Leerstelle“ (382) ebenso schließen wie sie sich vom „methodologischen Nationalismus“ ihrer historischen Ausgangssituation (383) lösen müsse. Mit ihr, so schließt Hirsch, könne „nur dann produktiv weitergearbeitet werden“, wenn „der enge Rahmen einer ‚Theorie mittlerer Reichweite‘ verlassen“ werde und sie „die Qualität einer Kritik der politischen Ökonomie auf der Höhe der Zeit“ erhalte (394).
Zweifellos fühlt sich der Leser, nachdem er den oft bewundernswert filigranen theoretischen Argumentationen des Bandes und einigen klugen und blicköffnenden Analysen empirischer Felder gefolgt ist, im Sinne des Verstehen und Erklären-Könnens doch ziemlich „Fit für die Krise“. Bezogen auf die Kräfteverhältnisse im Sinne emanzipatorischer Veränderung ist der Ertrag aber ernüchternd – sicher nicht deshalb, weil den Autoren der Blick dafür fehlte. Die Erwähnung von Gegenkräften bleibt so peripher, wie sie im Krisenverlauf – trotz gelegentlich spektakulärer und ermutigender Ansätze – bislang geblieben sind.
Download als PDF